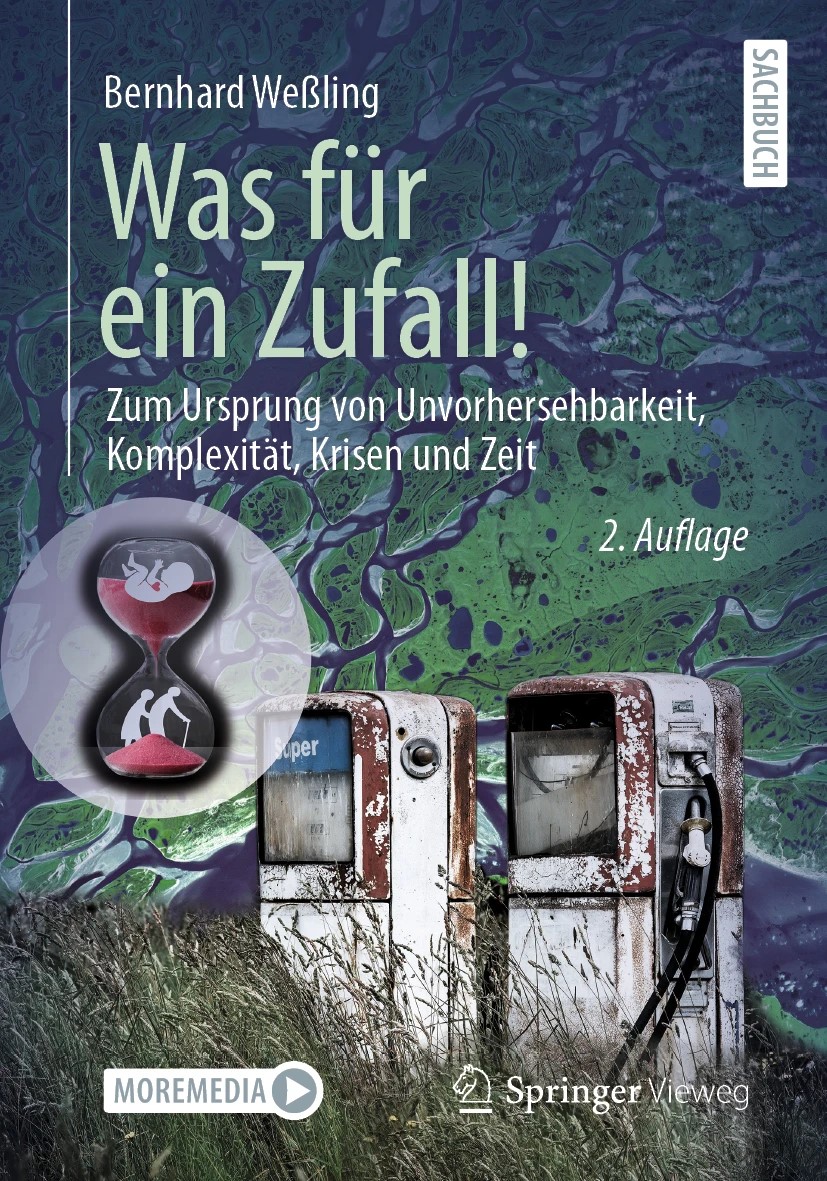
Buchauszug Bernhard Weßling „Was für ein Zufall! Zum Ursprung von Unvorhersehbarkeit, Komplexität, Krisen und Zeit“
Bernhard Weßling hat seit einiger Zeit wissenschaftlich untersucht, ob technologische (industrielle) Verfahren zur Verminderung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre (wie DAC, CCS, CCU) nachhaltig sind. Dazu hat er ein neues Konzept entwickelt, wie man Nachhaltigkeit objektiv beurteilen und sogar messen kann. Mitte März kam sein neues Buch heraus, in dem diese neuartigen, wissenschaftlich solide fundierten Gedanken für jedermann verständlich in erzählerischer Form Schritt für Schritt erklärt werden. In Kapitel 7 wird deutlich, dass industrielle Verfahren zur CO2-Entnahme und -Speicherung alles andere als nachhaltig sind, noch viel weniger nachhaltig sind Verfahren zur CO2-Nutzung (CCU).
Es ergibt sich daraus die Frage: Was können wir [statt dessen] tun – und was die Natur? So lautet die Überschrift von Kapitel 8, in dem der Autor die weithin unterschätzten Potenziale natürlicher Ökosysteme wiederum mit zahlreichen Daten und Fakten aus der Literatur belegt. Seine Botschaft ist: Klimawandel und die Krise der Artenvielfalt müssen wir gemeinsam und gleichzeitig angehen. Dazu kann und muss auch die Biolandwirtschaft, wie sie unser Kattendorfer Hof betreibt, einen großen Beitrag leisten. Darum geht es in dem folgenden Auszug aus seinem Buch (S. 253 – 259):
Vielleicht ist es Ihnen nicht aufgefallen, aber mehrfach erwähnte ich Weiden, also Wiesen, auf dem Wiederkäuer weiden; damit kein Missverständnis aufkommt: Ich meine damit nicht Grünland, das chemisch gedüngt, mit Pestiziden von Insekten und Unkraut freigehalten wird, damit nur grünes Gras wächst, das man mehrfach im Jahr abmähen kann als Futter für die Kühe, die das ganze Jahr im Stall stehen. Nein, ich meine damit Wiesen, auf denen Milchkühe, ihre Kälber und die Bullen, oder auch Galloway- und Highlandrinder, weiden dürfen. Wiesen, auf denen keine Chemie ausgebracht wird, die stattdessen voller Wildkräuter sind, Wiesen, auf denen es blüht und summt und auf denen frische und ältere Kuhfladen liegen, auf denen und um diese herum es besonders intensiv summt und brummt.
Mir ist klar, dass zumindest einige Leser ihre Zweifel an Milchwirtschaft haben, weil Kühe in den Medien oftmals pauschal als Klimakiller tituliert werden, wegen ihres Methanausstoßes. … Wie so viele einfache Gleichungen in der Ökologie ist aber diese schlichte Sichtweise „Kuh = Klimakiller“ nicht haltbar, sie erweist sich bei genauerer Betrachtung als bestenfalls eindimensionale (und eher grundfalsche) Sicht, als eine Betrachtungsweise, die für komplexe Systeme und Prozesse nicht angemessen ist. Von solchen Systemen und Prozessen handelt dieses Buch vom Anfang bis zum Ende, und daraus besteht unsere Welt. Deshalb hole ich etwas weiter aus:
Wiederkäuer gibt es auf der Erde seit dem Eozän. Ohne hier die Artensystematik darzulegen, erwähne ich nur eine knappe beispielhafte Auswahl an Arten, dazu gehören: Giraffen, Moschusochsen, Gnus, Hirsche, Rehe und Elche, Steinböcke, Rinder, Schafe und Ziegen; auch Kängurus, Kamele und Lamas sind Wiederkäuer. Bevor Europäer nach Nordamerika kamen und das Land übernahmen, lebten etwa 50 Mio. Bisons in der dortigen Prärie (das ist Grünland, wenn man so will: eine sehr große Weide, eine riesige wilde beweidete Wiese!). Und das waren bei weitem nicht die einzigen Wiederkäuer, die die Prärie und die Wälder durchstreiften. Ähnlich sah (und teilweise sieht es heute noch) in den Savannen Afrikas aus, wo sogar derzeit immerhin noch etwa 1,5 Mio. Gnus leben. Vermutlich in nicht ganz so großen Populationen (Populationsschätzungen sind bisher nicht möglich) lebten am Ende und nach der Eiszeit in Europa die Moschusochsen, Auerochsen (die seit Urzeiten in ganz Eurasien und Nordafrika grasten und wiederkäuten, später zu unseren heutigen Rindern domestiziert wurden und bald ausstarben) und Steppenbisons sowie Wisente, die sich aus Mischlingen zwischen Auerochsen und Steppenbisons entwickelt hatten, aber auch zunehmend weniger zahlreich waren).
Ebenso Elche und Hirsche, Rehe und Rentiere. Aber mehr und mehr wird klar, dass Mitteleuropa nicht einfach von einem dichten dunklen Wald bewachsen war, sondern von einer parkähnlichen Landschaft, in der sich reich strukturierte Wälder mit grasbewachsenen Lichtungen und größeren Graslandschaften abwechselten, abgesehen von den regelrechten Steppenlandschaften, die wir ja auch heute noch in Europa finden. Und überall dort grasten Wiederkäuer, und auch Wildpferde und Waldelefanten hielten die Wälder offen. Alle Wiederkäuer sind seit jeher Landschaftsgestalter: Sie fressen und verdauen Pflanzen, halten die Wälder offen, öffnen die Böden und bereiten so immer wieder neue klein- und großflächige Lebensräume für viele andere Tier- und noch mehr Pflanzenarten vor. Allein Rehe gibt es heute in Deutschland etwa 2,5 Mio. hinzu kommen 200.000 Rothirsche und zusätzlich Damwild. Zum Vergleich: Es gibt gut 10 Mio. Rinder in Deutschland. Ja, es sind zu viele; ja, Rind- und Schweinefleisch ist dort, wo es in Massen verkauft wird, viel zu billig; und ja, es wird ohnehin zu viel Fleisch gegessen. Aber das ist es nicht, was ich hier diskutieren will, sondern die prinzipielle Frage:
Sind Kühe Klimakiller? Wir haben für die Antwort zuerst einen Blick zurück geworfen und festgestellt: Nicht nur Kühe sind Wiederkäuer mit Methan-Ausstoß, sondern viele andere Wildtier- und domestizierte Arten (auch Schafe und Ziegen), und es gibt sie seit zwei, drei Dutzend Millionen Jahren. Methan wurde also immer schon emittiert – und nicht zu knapp. Seit Jahrmilliarden gibt es auf der Erde den Methankreislauf, über den vieles noch nicht bekannt ist. Gewisse Mikroben erzeugen Methan, andere leben davon, und Methan wird in der Atmosphäre oxidativ abgebaut zu CO2 und H2O.
Was aber über die Rinder speziell und Wiederkäuer insgesamt bekannt ist, insbesondere wenn Weiden extensiv genutzt werden, widerspricht der Klimakiller-Erzählung. Denn damals schon haben die grasenden Wiederkäuer (übrigens zusammen mit den nicht wiederkäuenden Wildpferden) ständig dafür gesorgt, dass Graslandschaften entstanden und lange bestanden, was eben auch die Humusbildung und schließlich die Endlagerung des Kohlenstoffs im Boden bewirkt, mithilfe der Mechanismen, die wir [auf den vorigen Seiten des Kapitels] kennengelernt haben. Aber es geschieht noch mehr, was Florian Schwinn in seinem Buch Die Klimakuh recht plastisch, geruchs-, klang- und farbenfroh beschreibt:
Nachdem eine Kuh ihren Fladen abgesetzt hat, sind schon nach Minuten die ersten Dungfliegen dort und nur wenig später die Dungkäfer. Es werden Eier gelegt, die Dungkäfer fressen vom Kuhfladen, und es werden mehr und mehr verschiedene Fliegen und Käfer. Der Heilige Pillendreher (Vorkommen im Mittelmeerraum und in Afrika) formt aus dem Dung eine Kugel, die er wegrollt und vergräbt, das Weibchen legt ein Ei dort hinein. Unsere hiesigen mit diesem verwandten Dungkäferarten nutzen ebenfalls die Kuhfladen und den Pferdedung, so graben Mistkäfer tiefe Röhren, um den Dung nach im Boden einzulagern und für sich zu nutzen. Nun sind die Regenwürmer an der Reihe und leisten ihren Beitrag zu den Abläufen, die wir bereits oben angesprochen haben. Eine solche – extensiv genutzte – Weide ist etwas ganz anderes als eine Heuwiese, die mehrmals im Frühjahr und Sommer gemäht wird. Diese ist praktisch eine Monokultur der am schnellsten und dichtesten nachwachsenden Gräser (gut für den Heuertrag), die als solche genutzte Weide ist ein Eldorado der Biodiversität, der Humusbildung und der Kohlenstoffspeicherung.
Schwinn zitiert Jörn Buse, der schreibt: „Damit liefert bereits ein [einziges] 600 kg schweres Rind im Laufe eines Jahres über elf Tonnen Dung auf Weideflächen. Der durch 120 kg Insektenlarven genutzt wird.“ Das heißt, eine Kuh liefert im Verlauf eines Jahres die Grundlage für das Entstehen und Leben von Insekten mit dem Gesamtgewicht von einem Fünftel des Gewichts der Kuh. In einem einzigen Kuhfladen können bis zu 4.000 Insektenindividuen zu finden sein, zusammen mit den Tieren aus dem Boden mehrere hundert verschiedene Arten. Hinzu kommen zahllose Fliegen und Schmetterlinge, die den Kuhfladen nur kurz besuchen. Das ist aber nur der Fall, wenn die Kuh nicht, wie leider derzeit die allermeisten, im Stall steht, sondern wenn sie auf der Weide ist und grast. Ähnlich wird auch der Kot anderer Weidetiere, der Schafe, Ziegen oder Pferde, genutzt und verarbeitet, und natürlich auch der von Hirschen und Rehen, wenn diese die Wälder verlassen können und im offenen Grünland äsen.
Dass den Insekten in den extensiv beweideten Graslandschaften auch die Vögel folgen, muss ich sicher nicht näher erklären. Jeder kann es selbst beobachten. Pro Jahr und Hektar können auf beweidetem Grünland nach Zahlen des Thünen-Instituts 2,22 t Kohlenstoff gespeichert werden. Das entspricht jährlich 8,15 t CO2, die der Atmosphäre entzogen werden. Hier wurde nicht speziell hinsichtlich biologisch oder konventionell bewirtschaftetem Grünland differenziert, für ersteres dürften die Zahlen nochmals höher liegen. Konventioneller Ackerbau zeigt hingegen einen jährlichen (!) Verlust in Höhe von 0,2 t Kohlenstoff. Lassen Sie uns die Speicherung dieser gut 8 t CO2 vergleichen mit dem Energiebedarf, den die direkte Absorption von CO2 aus der Luft (DAC) verursacht: In Kap. 7 konnten Sie lesen, dass dies pro Tonne CO2 neun Mio kJ Primärenergie erfordert, also 9 GJ. Ein (1) Hektar beweidetes Grünland erspart also jährlich einen Energieaufwand in Höhe von 73,35 GJ Primärenergie, den wir benötigen, wenn wir ebenfalls 8,15 t CO2 aus der Luft mittels DACCS entfernen und speichern würden.
Aber wir speichern nicht nur CO2, sondern bekommen auch noch Fleisch und Milch. Auf unserem Kattendorfer Hof grasen 2,5 Milchkühe pro Hektar, von denen (ausschließlich ernährt mit selbst angebautem Futter und frischem Gras) jede einzelne im Mittel fast 6.000 Liter Milch pro Jahr liefert. Entsprechend viel Milch wird von den 2,5 Kühen pro Hektar geliefert: fast 15.000 Liter im Jahr, zusätzlich zur CO2-Speicherung und der Bereitstellung von Kinderstuben und Nahrung für Milliarden von Insekten (2,5*120 kg = 300 kg Insektenlarven im Jahr)! Ein einziger Hektar leistet dies alles zusätzlich zur Einsparung von 73,35 GJ Primärenergie, die wir nicht mit DACCS verschwenden müssen, und wir vermeiden all die [in Kapitel 7] beschriebenen Kollateralschäden. Man muss die Zahlen nur hochrechnen, um festzustellen, dass beweidetes Grünland eine DACCS-Methode mit sehr viel mehr Speicherpotenzial ist als eine Climeworks-Anlage (und das praktisch ohne Energieaufwand). Und zugleich fördert es die Biodiversität. Und erzeugt gesunde Lebensmittel.
Florian Schwinn weist mit seinem Buch auf etwas hin, was ich (als Investor und Mitgeschäftsführer des erwähnten Biolandwirtschafts-Betriebs) eigentlich hätte wissen können oder müssen: Bei der Klimakonferenz 2015 in Paris haben die Gastgeber eine 4-Promille-Initiative ins Leben gerufen, der die Bundesrepublik beigetreten ist. Diese basiert auf der Erkenntnis, dass wenn auf allen weltweit landwirtschaftlich genutzten Flächen nur 4 Promille mehr Humus gebildet würde, könnten diese Böden die gesamte Menge des derzeit emittierten CO2 speichern und in tieferen Bodenschichten endlagern.
Dass ich von dieser Initiative noch nie etwas gehört oder gelesen hatte, beschämt mich, zugleich ist es aber auch beschämend für die Initiatoren und die Medienschaffenden, denn offensichtlich ist kaum etwas davon an die breitere Öffentlichkeit gelangt (Schwinn schreibt: „Nur geschehen ist seither wenig“; wie wahr …). Das einzige, was mich etwas besänftigt, ist: Als ich 2009 in den Kattendorfer Hof investierte, bewirtschaftete dieser erst „nur“ 110 ha Pachtland. Danach begannen wir zu wachsen und bewirtschaften heute auf biologische Weise 450 ha Pachtland. Davon einen großen Teil mit allerlei Feldfrüchten (Brot- und Futtergetreide / Triticale, Futtererbsen und Ackerbohnen, Klee, Kartoffeln), einen weiteren großen Teil als Weiden für unsere Kühe, Kälber und Bullen. Wir betreiben eine eigene Käserei, neben der Milchwirtschaft und Rinderzucht auch Schweinezucht, denn die Schweine lieben die Molke aus der Käserei! und fressen nur allzu gern die nicht mehr verkaufsfähigen Kartoffeln und viele andere Reste aus unserer Produktion. Zusätzlich sind zwei große Gemüseanbauflächen für mehr als 50 Gemüsearten Teil unserer Pachtflächen.

Bernhard ist promovierter Chemiker und Unternehmer; er ist seit 16 Jahren Investor in der Kattendorfer Hof- und der Hofladen-KG und seit 8 Jahren einer der Geschäftsführer.
Da wir nach und nach immer mehr ursprünglich konventionell bewirtschaftete Acker- und Weideflächen übernommen haben, haben wir weit mehr als vier Promille zusätzlichen Humus gebildet. Denn der Humusgehalt in Ackerböden industriell landwirtschaftlich arbeitender Betriebe nimmt nachweislich Jahr für Jahr ab: pro Hektar Ackerland 0,2t reiner organischer Kohlenstoff geht jährlich verloren. Und wenn man mit einem Spaten in den Boden sticht und einen Blick hineinwirft, sieht man das Elend: Nur wenn man mehrfach an verschiedenen Stellen hineinsticht, erkennt man auch mal ein Bodenlebewesen.
Ganz anders auf unseren biologisch bewirtschafteten Flächen: Eine einzige Stichprobe an beliebiger Stelle zeigt eine unübersehbare Vielfalt an Bodenleben, schon rein visuell, und das bis zu 25/30 cm tief. Nachweislich ermöglicht ökologische Landwirtschaft über die Jahre hinweg einige Prozent zusätzlichen Humusaufbau. Das schon allein deshalb,
weil nicht mit Mineraldünger gedüngt wird, sondern mit Stallmist; und weil die Bodenbearbeitung nur sehr flach und nicht umgrabend erfolgt; und nicht zuletzt weil wir in einer 6jährigen Fruchtfolge nach humus- und nährstoffzehrenden Ackerfrüchten Gründünger und stickstofffixierende Pflanzen anbauen, immer im Wechsel. Allgemein ist es so, dass Humusuntersuchungen bislang noch selten und somit nur wenig quantitative Daten verfügbar sind. Nachweisbar ist aber: Während konventioneller Landbau Humusverluste im Maßstab einiger Prozentpunkte pro Jahr verursacht, wächst der Humusgehalt ökologisch bewirtschafteter Böden jährlich um einige Prozent. Man beachte: nicht 4 Promille nach soundsoviel Jahren, sondern einige Prozent pro Jahr zusätzlich!
—-
Das Buch ist im großen Wissenschaftsverlag „SpringerNature“ erschienen und kann ganz normal im Buchhandel bestellt werden, oder auch direkt beim Verlag, entweder als ebook oder als gedrucktes Buch.